
3 Dinge im Leben, die wir riskieren sollten
Manchmal führen Dinge und Erlebnisse im Leben dazu, dass wir uns ein Vermeidungsverhalten antrainieren, dass uns mehr schadet als uns nützt. Dass uns auch viel Energie abverlangt, die wir besser dafür nützen könnten, unser Leben mehr zu genießen und die Dinge zu erreichen, die wirklich wichtig sind. Zumal wir auch versuchen, Dinge und Gefühle zu vermeiden, die zum Leben dazu gehören.
Ich weiß, wovon ich spreche, denn ich bin selbst ein Vermeider. Ich riskiere oft zu wenig. Und der Preis dafür ist, dass ich mich manchmal einfach nicht „ganz“ fühle, nicht zugehörig und nicht vollständig gesehen.
Hier meine Top 3, der Dinge im Leben, die wir riskieren sollten – und die ich selbst oft genug noch versuche zu vermeiden.
1. Ablehnung riskieren
Ich bin ein Mobbing-Opfer. Ich gehörte beispielsweise zu den Menschen, die in der Sportschule beim Wählen von Gruppen immer zu den letzten beiden gehörten. Außer mir gab es ansonsten auch nur noch Susanne. Susanne war dicker als ich, deshalb durfte sie einmal in einem Theaterstück mit ihrem Hintern den aufgehenden Mond spielen. Ich war nicht das einzige Mobbingopfer (und mir wurden auch bei weitem schlimmere Dinge angetan, als „nur“ als Letztes gewählt zu werden). Ob Susanne mich mochte, war mir immer egal. Mein Blick galt den Angesagten und Coolen, zu denen wollte ich gehören, an denen orientierte ich mich.
Das ist ein Stück weit noch immer so. Ich möchte zu den Beliebten gehören. Zu denen, die definitiv nicht als letztes gewählt werden. Wenn ich in neue Gruppen komme oder überhaupt neue Menschen kennenlerne, dann gibt es immer noch den Augenblick, in dem ich denke: „Hoffentlich mögen die mich. Hoffentlich finden sie mich nicht komisch.“
Das ist menschlich. Aber wie bei vielen anderen Mobbingopfern, ist das auch bei mir irgendwann aus dem Ruder geraten. Wir wollen alle gemocht werden, wir wollen alle dazu gehören. Wir sind darauf gepolt. Zu einer Gruppe zu gehören ist überlebenswichtig, das flüstert uns unser Urmensch immer noch ein.
Wenn aber unsere Anpassungsbemühungen dazu führen, dass wir nur noch ein Schatten dessen zeigen und geben, was wir sein könnten und geben könnten, dann wird es fehlerhaft. Dann spüren wir auch eine ganz profunde Wahrheit: Anpassung ist nicht dasselbe wie Zugehörigkeit. Anpassung heißt, dass mich Menschen für etwas lieben, was ich im Zweifelsfall gar nicht bin.
Wenn ich aber bin, wie ich bin, wenn ich aufhöre mich in Anpassungszwänge zu begeben, dann werde ich unweigerlich Ablehnung erfahren. Es wird Menschen geben, die mich nicht mögen. Einfach so, es muss nicht mal einen Grund dafür geben.
Früher wollte ich diesen Grund immer herausfinden. „Warum magst Du mich nicht, ich bin doch nett? Was muss ich tun oder sagen, damit du mich magst?“.
Aber wenn ich etwas tue oder sage, nur damit du mich magst, dann bin ich irgendwann nicht mehr authentisch. Übrigens auch etwas, was wir bei manchen Menschen spüren können: das Unechte.
Menschen, die mich mögen, weil ich mich ihnen anpasse, mögen in Wirklichkeit nicht mich. Und deshalb entsteht auch keine wirkliche Verbundenheit oder Zugehörigkeit.
Ich muss so sein, wie ich bin – und dabei Ablehnung riskieren – um die Menschen zu finden, mit denen ich mich verbunden fühlen kann. Und lernen, dass es eine Menge anderer Menschen gibt, die mich nicht mögen werden. Ich kann nicht von allen gemocht werden. Aber ich kann mich selbst beim Versuch von allen gemocht zu werden aufreiben und verlieren.
2. Peinlichkeiten riskieren
Einer meiner besten Tage im letzten Jahr, war der Besuch im Kletterpark. Ich war schon oft da, aber ich bin nie mitgeklettert. Ich habe Höhenangst. Und außerdem bin ich übergewichtig, nicht besonders koordiniert und bestenfalls mittelmäßig sportlich. Ich lehnte immer ab zu klettern, obwohl ich es eigentlich gerne probiert hätte. Ich dachte, es würde furchtbar peinlich werden, wenn ich im niedrigsten Parkour irgendwann mich feste an irgendwas klammernd nicht mehr weiterkäme. Vermutlich würde es sowieso lächerlich aussehen, wenn ein dicker, ängstlicher Mensch sich kriechend über die Hindernisse quält.
Aber an diesem Tag fuhr ich hin und dachte: „ach Scheiß doch drauf. Und wenn ich nach zwei Metern wieder runter muss und es nicht schaffe, dann habe ich es wenigstens mal probiert. Und Menschen, die sich dann darüber lustig machen oder mich auslachen, die können mich mal kreuzweise. Wenn ihr nicht wisst, wie das ist, wenn man Angst hat, wirklich Angst, und wenn man sich wirklich etwas trauen muss und all seinen Mut zusammennehmen muss – dann spart euch eure dummen Sprüche und euren Spott, denn dann habt ihr kein Recht dazu. Dann seid ihr nur arme Wichte, empathielos und ätzend und das sagt mehr über euch aus, als über mich.“
Am Ende schaffte ich zwei von sieben Parcours. Ich war völlig fertig. Vor allem der zweite Parcour – in einer schwindelerregenden Höhe von 2Metern! – hatte alle meine Energie gefordert. Ich hatte Angst, ich klammerte mich fest, ich kroch auf allen vieren. Als ich runterkam war ich durchgeschwitzt, müde…und stolz…unglaublich stolz. Und niemand hatte gelacht. Oder ich bekam es nicht mit. Es wäre mir auch egal gewesen.
Die ätzendsten Kommentare kamen aber an diesem Tag nichtsdestotrotz von demjenigen, der sich selbst nicht traute. Er sagte Dinge wie „Du hältst den ganzen Laden auf“, wenngleich auch zu jemand anderem. Und es ist eigentlich symptomatisch. Ich meine, es ist ok, wenn du auf der Zuschauerbank sitzen bleibst – aber dann urteile nicht über die, die Peinlichkeit und Spott riskieren. Brené Brown formulierte es mal in etwa so: das Urteil von Menschen, die sich selbst nicht zeigen und in die Arena treten, sollten wir uns nicht zu Herzen nehmen.
Wenn wir Peinlichkeiten und Spott nicht riskieren, entgeht uns eine Menge Spaß. Wir haben Angst davor, dass uns der Spott und die Häme den Spaß kaputt machen. Und ja, es wird uns manchmal verletzen. Wie der mir unbekannte Mensch, der mir beim Joggen mal hinterherrief: „wenn du dünner werden willst, musst du aber schneller laufen. Schneller! Schneller!“.
Aber wir sollten nicht mit den Dingen aufhören, die uns peinlich oder unangenehm sein könnten, sondern mit den Menschen, die uns das Gefühl geben, es sollte uns peinlich sein. Wir sollten uns mit denen umgeben, die uns in so einer Situation anfeuern, ermutigen oder die zumindest Verständnis zeigen. Und die finden wir nur, wenn wir den peinlichen, gefährlichen, seltsamen, unbehaglichen Situationen nicht aus dem Weg gehen.
3. Scheitern riskieren
Meine Selbstständigkeit mit SEO&Co, Kompasszeit, das Bücher schreiben…all das sind Dinge, mit denen ich scheitern könnte. Ich habe einen sicheren Job aufgegeben, um herauszufinden, was ich wirklich möchte und wer ich wirklich bin. Und es könnte schief gehen. Eines Tages, so spinnt es sich in meinem Kopf zusammen, wache ich vielleicht unter einer Brücke auf und mein innerer Kritiker wird brüllen: „Siehste! Hab ich dir doch gesagt!“.
Und manchmal denke ich, es wäre viel leichter gewesen, weiter zu machen. Mit dem sicheren Job und allem anderen. Denn manchmal ist es leichter zu leiden, als etwas zu verändern. Vor allem, wenn der Ausgang offen ist.
Mein Kopf malt auch aus, dass mich viele Menschen auslachen werden, wenn ich scheitere. Dass sie nicht sagen werden „wie mutig, dass du es versucht hast“, sondern dass sie sagen werden „das hättest du dir wirklich zweimal überlegen sollen“. Oder „das war von Anfang an eine Schnapsidee“.
Das könnte alles eintreten. Und unser Gehirn ist ja auch wirklich gut darin, die Ernstfälle zu proben. Wir sind Meister darin, uns schlechte Ausgänge auszumalen. Und wenn unser Gehirn all die schlechten Ausgänge durchdacht hat, wird es plötzlich unglaublich schwer überhaupt loszugehen. Es zu versuchen. Dabei kann unser Gehirn ein paar Dinge gar nicht gut durchspielen: welche Erfahrungen wir machen würden, trotz allem. Was wir lernen würden. Welche anderen Türen sich vielleicht öffnen würden. Wir sind darauf getrimmt, Scheitern als etwas durchgängig Schlechtes zu sehen, mit schlechten Konsequenzen. Als Schwäche. Als Versagen. Als einen Makel. Ein Misserfolg – und weil unser Gehirn so gerne Muster sieht vervollständigt es die gedankliche Reihe mit „einmal scheitern – immer scheitern“. Was die Bedrohung nur umso größer macht.
Aber es liegt ein Gewinn, eine unglaubliche Stärke im Scheitern. Das Scheitern zeugt von Mut. Wir müssen uns trauen zu scheitern. Wenn wir lernen wollen, wenn wir neue Wege einschlagen wollen, wenn wir etwas verändern wollen. Dann müssen wir uns trauen zu scheitern. Nur wer hinfällt, kann wieder aufstehen. Und in dem Aufstehen liegt vielleicht der Moment unserer größten Stärke. Manchmal dauert es vielleicht bis wir wieder aufstehen, das ist in Ordnung. Aber was nicht in Ordnung ist, einfach stehen zu bleiben und sich nicht zu trauen, den Weg zu beschreiten den man beschreiten möchte, weil man hinfallen könnte. Denn dann wirst du einen Teil deiner Stärken niemals kennen lernen.
Das waren die 3 Dinge im Leben, die wir riskieren sollten. Ich feuere jeden da draußen an, der den Mut aufbringt Neues zu wagen. Jeden, der wieder aufsteht, egal wie schwer es manchmal ist. Und es kann verdammt schwer sein, das weiß ich. Mit psychischen Krankheiten wird es sogar manchmal noch mal schwerer, wenn der Kopf einfach gar keine positiven möglichen Ausgänge sehen kann. Aber es ist nicht das Scheitern, dass Angst machen sollte. Sondern das Gefühl, dass man bekommt, wenn man es nicht versucht.
Ich freue mich über einen Kommentar von Dir! Erzähl mir Deine Mutgeschichte!
Gerne kannst Du mir auch auf Instagram oder Facebook folgen. Und viele meiner Texte findest auch hier: Downloads.



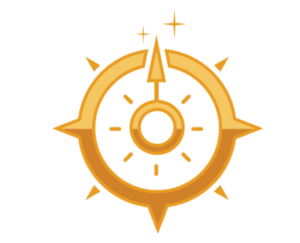



3 Comments
Sabiene
Ich finde es sehr schwierig, Ablehnung zu riskieren. Daraus folgert sich dann auch ein bisschen die Angst vor Peinlichkeiten oder vor dem Scheitern.
Wahrscheinlich werden gerade Mädchen so erzogen, oder?
LG
Sabiene
Annette (KompassZeit)
Ich denke eher Männer und Frauen werden unterschiedliche Versagensängste antrainiert. Während es bei Frauen/Mädchen ganz oft immer noch um Benehmen, Aussehen, oder Perfektionismus (alles hinkriegen müssen: Familie, Haushalt, Beruf, etc.) geht, ist bei Männern meiner Beobachtung nach immer noch oft das Thema Emotionen zeigen (insbesondere Angst), ein Beschützer sein, ein Held sein, ein „echter“ Mann sein. Wenn ich mich gerade recht erinnere ist die Anzahl der Selbstmordversuche bei Männern ja auch noch mal höher als die bei Frauen und ich denke das kommt nicht von ungefähr.
Energie Audit Deutschland
Deine Reflexion über Vermeidungsverhalten und die Auswirkungen auf unser Leben ist äußerst berührend und ehrlich. Es ist wichtig, Mut zu finden, um Risiken einzugehen und sich seinen Ängsten zu stellen, um ein erfülltes Leben zu führen. Deine persönlichen Erfahrungen bringen eine tiefere Perspektive, die viele nachvollziehen können – das macht deinen Gedanken sehr kraftvoll und inspirierend.